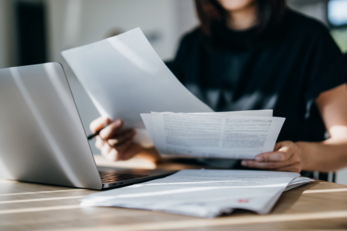6 Minuten07.11.2025
Der Wechsel von einer regelgeleiteten Sicherheitskultur hin zu einer Kultur der Eigenverantwortung muss bei Führungskräften anfangen. So setzen Sie die richtigen Impulse.
Wenn sich Arbeitsbedingungen und -umfelder ändern, wandeln sich auch die Voraussetzungen für Arbeitssicherheit. Nicht erst seit gestern fordern Globalisierung, Dynamiken in Lieferketten und steigender Zeitdruck Unternehmen heraus, ihr Verständnis und ihre Herangehensweisen für betriebliche Sicherheit kontinuierlich neu zu justieren.
Heute wissen wir: Sicherheitsmaßnahmen funktionieren am besten, wenn sie Teil der gelebten Kultur eines Unternehmens sind. Doch es ist herausfordernd, eine nachhaltige und effektive Sicherheitskultur zu etablieren. Erkenntnisse aus der Psychologie und Neurowissenschaft können dabei helfen.